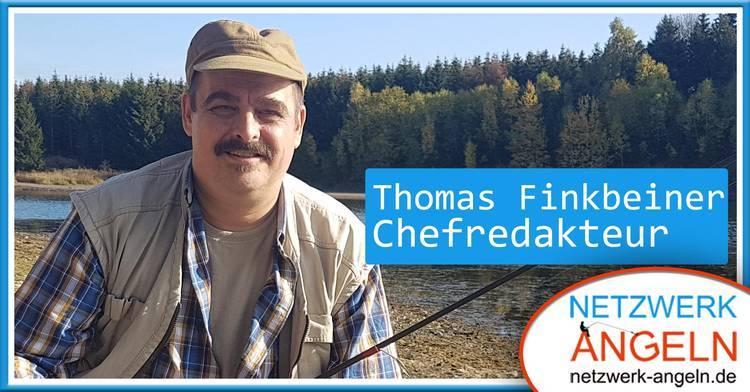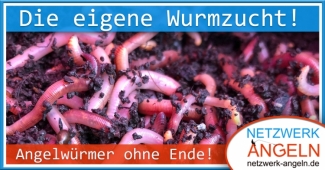Keinerlei Verbesserung für Angler ab 2026 erreicht: Wieder komplettes Versagen von DAFV, DMV und den Landesverbänden an der Küste.
Am 27.10. 2025 hat der EU-Ministerrat über die Fangquoten der Berufsfischerei und damit auch über das Baglimit für Dorsch und Lachs etc. beim Angeln in der Ostsee 2026 entschieden.
Auch 2026 bleibt das Dorschangeln verboten, beim Lachs bleibt es auch so schlecht wie es war: Ein gezüchteter Lachs (ohne Fettflosse) pro Tag und Angler.
Ob auch wie 2025 nach dem ersten Lachs ist das Lachsangeln einzustellen ist, das ist wahrscheinlich, aber noch nicht sicher.
Berufsfischerei auf Plattfisch bleibt erlaubt, daher "braucht" die Fischerei die Dorschquote als Beifangquote, die leider weiterhin gewährt wurde.
Da sich nichts geändert hat, schon gar nicht psitiv für Angler, nachfolgend der immer noch gültige Text aus 2025.
Fakten: Das Dorsch-Baglimit 2025 im Detail!
Das Baglimit 2025 für Dorsche in der westlichen Ostsee (ICES 22 - 24, das betrifft Angler und Angeltourismus in Deutschland) wurde am 21. Oktober 2024 vom EU-Ministerrat festgelegt auf:
0 Dorsche pro Angler pro Tag
Die 5 wichtigsten Fragen und Antworten zum Baglimit auf einen Blick.
| Frage | Antwort |
|---|---|
| Wie hoch ist das Baglimit 2026 für Dorsche in der Ostsee? | Das Tagesfanglimit für die Freizeitfischerei (Angler) beträgt 0 Dorsche pro Angler pro Tag. |
| Wo ist das Baglimit 2026 gültig? | Das Baglimit für Westdorsch ist gültig in den ICES Gebieten 22, 23 und 24. Das betrifft die westliche Ostsee und damit im Wesentlichen nahezu alle von deutschen Anglern angesteuerten Angelplätze an der deutschen Ostsee sowie in Dänemark ( siehe auch untenstehende Karte ). Beispielsweise: Heiligenhafen, Fehmarn, Rügen, Kieler Bucht, Als, Fünen, Kleiner Belt, Kadettrinne, Öresund, Langeland, Eckernförder Bucht, Flensburger Bucht usw. |
| Ab wann ist das Baglimit 2026 gültig? | Das im Oktober 2024 beschlossene Baglimit für Dorsche in der Ostsee ist ab dem 01.01.2025 gültig. Das Baglimit bezieht sich immer auf einen Kalendertag, das ist vor allem für Brandungsangler relevant, da nach 0.00 Uhr ein neuer Kalendertag beginnt. |
| Wird das Baglimit kontrolliert? | Ja, das Baglimit wird von den einzelnen Mitgliedsstaaten stichprobenartig kontrolliert. |
| Gibt es auch für andere Fischarten ein Baglimit in der Ostsee? | Ja, erstmals wurde auch 2022 für Angler der Lachs von der EU reguliert. 1 Lachs pro Tag und Angler ist erlaubt, das bleibt so. Nach dem ersten Lach ist das Lachsangeln einzustellen. Ebenfalls dürfen keine Aale in der Ostsee geangelt werden. Ggf. kann es aber spezielle oder verschärfte Fangeschränkungen durch Mitgliedsstaaten geben. Mit weiteren Verschärfungen in den kommenden Jahren durch die EU ist zu rechnen |

Einordnung: Wie sind Fangquoten und Baglimit für 2026 zu bewerten?
Ein großer Teil der erlaubten Dorschquote wurde von Schleppnetzfischern gefangen. Den Fischern die auf Plattfisch fischen (auch zum Teil mit Schleppnetzen) soll daher die Restquote erhalten bleiben als "Beifangquote". Dass Anglern nun auch das Dorschangeln komplett verboten wurde wird em Bestand nicht nützen, nur der Berufsfischerei.
Ein Verbot jeder Schleppnetzfischerei in der Ostsee und der kompletten Dorschfischerei wäre die einzig sinnvolle und nachhaltige Bewirtschaftung abseits des Angeltourismus.
Obwohl Angeln und Angeltourismus nachgewiesen die einzig nachhaltige Bewirtschaftung der Bestände ist, wurde von Deutschland und der EU systematisch die Berufsfischerei weiter subventioniert und die schädliche Schleppnetzfischerei bleibt sogar in Schutzgebieten erlaubt!
Zudem erhält die Fischerei weiterhin Millionensubventionen aus Brüssel trotz der Schädlichkeit für die Bestände.
Dass weiterhin die ökonomisch gegenüber dem Angeltourismus unwichtige und ökologisch mehr als bedenkliche Berufs- und Schleppnetzfischerei Subventionen bekommt, während beim ökologisch und ökonomisch nachhaltigen Angeln und Angeltourismus die bisherigen Einschränkungen ohne jeden Ausgleich drastisch verschärft werden, ist weder aus fachlicher noch aus politischer Sicht nachvollziehbar.
Nachhaltigkeit unerwünscht - keine Förderung des schonenden Angeltourismus!
 Angler entnahmen deutlich weniger Fisch als die Berufsfischerei
Angler entnahmen deutlich weniger Fisch als die Berufsfischerei
Die Gesamtfänge der Freizeitfischerei auf Dorsch betragen im Mittel der letzten Jahre 2017-2019 lediglich 27,5% der Gesamtanlandungen (kommerzielle Fischerei und Freizeitfischerei. (Quelle WiSH "Baglimit Dorsch Ostsee 2021: Gemeinsame Forderung der Angeltouristiker an Berlin und EU", Dr. Zimmermann vom Thünen Institut spricht aktuell von nur "22%").
Zahlen zu unerlaubten Rückwürfen der Berufsfischerei an untermaßigen Dorschen sind dabei weder überliefert noch berücksichtigt. Ursache könnte da auch die von Dr. Zimmermann vom Thünen Institut angemerkte zu geringe Kontrolldichte sein.
Ein Problem sei die unzureichende Kontrolle der Fangquoten, sagt Zimmermann. So kämen in Mecklenburg-Vorpommern auf 340 Fischer und über 110 Anlandeorte nur 35 Inspektoren. Größere Schiffe würden per Satellitentechnik überwacht und müssten über jeden Fang Logbuch führen, bei den kleineren Booten unter acht Meter Länge sei der Kontrolldruck aber minimal, weil sie nur einmal im Monat angeben müssten, wann sie wo und was gefangen haben.
»Für eine zukunftsfähige Fischerei brauchen wir dringend bessere Daten, auch von den kleineren Booten«, sagt Zimmermann.
Quelle Spektrum.de, "Wider den letzten Fisch im Netz"
Obwohl die Angler nur für einen kleinen Teil am Fang beim Dorsch verantwortlich sind, erwirtschaften sie deutlich mehr volkswirtschaftlichen Umsatz und ernähren somit deutlich mehr Arbeitnehmer und deren Familien. Die verbliebenen Fischer erzielen beim Verkauf ihre Fanges (bei fast 80 % des Dorschfanges gesamt momentan) nicht einmal einen zweistelligen Millionenbetrag jeweils in der schleswig-holsteinischen Ostsee und der Ostsee in Mecklenburg-Vorpommern
(Quellen: Jahresbericht des Landesamts für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) Schleswig Holstein und Fangstatistik der Kl. Hochsee- und Küstenfischerei M-V 2019 Fanggebiete: Küstengewässer und Ostsee).
Hinzu kommt, dass es immer weniger Fischer mit immer weniger Mitarbeitern gibt, welche die erlaubte Quote unter sich aufteilen.
Dagegen würde der Angeltourismus bei vernünftiger Förderung großes wirtschaftliches Potential mit vielen Arbeitsplätzen bei gleichzeitig nachhaltiger Nutzung der Dorschbestände durch geringe Fangmengen (natürliches Baglimit) bieten. Das Umsatzvolumen des Angeltourismus an der Ostsee wird bereits bei den jetzt schlechten Bedingungen auf ca. 200 Millionen pro Jahr bei ungefähr 4.000 Arbeitsplätzen geschätzt (Hochrechnungen und Schätzungen laut WiSH e.V./ Thünen Institut).
Angler unterliegen einem natürlichen Baglimit!
Angler können nur vorhandene UND aktive Fische fangen, die mit ineffektiven Methoden und Ködern zudem erst überlistet werden müssen.
Ein natürliches Baglimit, das automatisch jeglicher Überfischung vorbeugt.
Angler können daher niemals einen Dorschschwarm komplett vernichten, wie es die Berufsfischerei mit den Schleppnetzen und der modernen Technik gerade um die Laichzeit herum problemlos schafft.
Angeltourismus geht weiter unter
Schon 2020 und 2021,nachfolgend auch 2022 hatte der Angeltourismus durch rigide Maßnahmen während der Corona-Maßnahmen im Frühjahr schwer gelitten - daraus resultieren auch ca. 500 Tonnen Minderfänge der Angler (Schätzungen WiSH e.V.). Schon alleine nur der Ausgleich dieser Mindermenge aus 2020 für 2021 und noch mehr 2022 und 2023 würde ungefähr einem Baglimit von ganzjährig 6 Dorschen pro Angler und Tag entsprechen. Die bisherigen Maßnahmen haben jetzt schon schwerste Schäden und Aufgaben bei an Angeltourismusbetrieben, insbesondere bei den Anbietern von Angelkutterfahrten, zur Folge. Inzwischen gibt es keine 10 Angelkutter mehr an den deutschen Ostseeküsten.
Wie wird das Baglimit für Angler festgelegt?
Die Festlegung des Baglimit beim Dorsch für Angler folgt einem immer gleichen Prozedere. Der ICES gibt auf Grund der Zahlen, welche wissenschaftliche Institute wie z. B. das Thünen-Institut für Ostseefischerei ermitteln, eine Empfehlung für die Fangmengen an die EU-Kommission und die DG MARE.
Ziel ist es, die durch die EU festgelegten mehrjährigen Bewirtschaftungsplanes beim Dorsch in der Ostsee einzuhalten. Die Kommission macht daraus einen Vorschlag an den Ministerrat der EU, wie hoch die Quote der Fischerei sein sollte und in welchem Umfang Angler und Angeltourismus berücksichtigt werden sollten.
Sobald der Vorschlag im Raum steht, versuchen Verbände und Lobbyisten für ihre jeweilige Klientel das beste Ergebnis zu erreichen. Das sind z. B. der VDKK e.V. für die Kutterfischer oder Netzwerker Lars Wernicke für den Angeltourismus über WiSH e.V. oder der DAFV (der für Angler darüber hinaus noch zusätzliche Beschränkungen fordert).
Mitte bis Ende Oktober wird dann auf den Tagungen des Ministerrates sowohl die Quote für die Berufsfischerei wie auch das Baglimit für Angler für das Folgejahr festgelegt.
Geschichte des Baglimits für Dorsche
Jahrzehntelang spielten die Angler und ihre Fänge beim Management der gewerblich genutzten Fischbestände in den Meeren der EU keine Rolle – auch der Dorsch in der Ostsee nicht. Dann wurden auf Grund der Schätzungen und Hochrechnungen der Dorschbestände in der Ostsee die Quoten der Berufsfischerei immer mehr eingeschränkt. Vom Bundeslandwirtschaftsministerium wurde auf Grundlage einer EU-Vorgabe das Thünen-Institut für Ostseefischerei in Rostock beauftragt, die Anglerfänge zu definieren und verschiedene Managementoptionen auszuarbeiten.
Mit daraus resultierte dann, dass 2016 das erste Baglimit für Dorsch von der EU für das Jahr 2017 beschlossen wurde.
Das Baglimit für Angler im Vergleich zu den Vorjahren:
| Baglimit 2017 | 5 Dorsche pro Tag, 3 Dorsche pro Tag in den Monaten Februar und März |
| Baglimit 2018 | 5 Dorsche pro Tag (die Schonzeit für Berufsfischer wurde wegen der guten Bestände aufgehoben, es gab es auch kein geringeres Limit in Februar/März für Angler) |
| Baglimit 2019 | 7 Dorsche pro Tag |
| Baglimit 2020 | 5 Dorsche pro Tag, 2 Dorsche pro Tag in den Monaten Februar und März |
| Baglimit 2021 | 5 Dorsche pro Tag, 2 Dorsche pro Tag in den Monaten Februar und März |
| Baglimit 2022 | 1 Dorsch pro Angler und Tag Zusätzlich wurde auch erstmalig der Lachs beschränkt: 1 Lachs pro Angler und Tag |
| Baglimit 2023 | 1 Dorsch pro Angler und Tag, 1 Lachs pro Angler und Tag |
| Baglimit 2024 | 0 Dorsch pro Angler und Tag, 1 Lachs pro Angler und Tag |
| Baglimit 2025 | 0 Dorsch pro Angler und Tag, 1 Lachs pro Angler und Tag |
| Baglimit 2026 | 0 Dorsch pro Angler und Tag, 1 Lachs pro Angler und Tag |
Anhänge, Quellen, Begriffserklärungen
ICES
Der International Council for the Exploration of the Sea wurde am 22. Juli 1902 in Kopenhagen von acht europäischen Ländern gegründet: Dänemark, Finnland, Deutschland, den Niederlanden, Norwegen, Schweden, Russland und Großbritannien. Erster Präsident des Rates war 1902–1908 der Deutsche Walther Herwig.
Mehrjahresplan
Es gibt für verschiedene Meeregebiete mehrjährige Bewirtschaftungspläne für gewerblich genutzte Fischbetsände in den Meeren der EU
Der Ministerat hat am 6. Juli 2016 den mehrjährigen Bewirtschaftungsplan für Dorsch, Hering und Sprotte in der Ostsee angenommen. Dieser Bewirtschaftungsplan ist der erste Mehrjahresplan, der im Rahmen der reformierten Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP) angenommen wurde.
VERORDNUNG (EU) 2016/1139 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur Aufstellung eines Mehrjahresplans für die Bestände an Kabeljau, Hering und Sprotte in der Ostsee sowie für die Fischerei auf diese Bestände zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2187/2005 des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1098/2007 des Rates
EU-Kommision, DG Mare
Die Europäische Kommission, kurz EU-Kommission, ist ein supranationales Organ der Europäischen Union. Im politischen System der EU nimmt sie vor allem Aufgaben der Exekutive wahr und entspricht damit ungefähr der Regierung in einem staatlichen System.
Die Generaldirektion Maritime Angelegenheiten und Fischerei (DG MARE oder GD MARE) ist eine Generaldirektion der Europäischen Kommission. Sie ist dem Kommissar für Umwelt, Maritime Angelegenheiten und Fischerei zugeordnet.
[1]Rat der EU, Pressemitteilung, 22. Oktober 2024 11:15
Ostsee: Rat einigt sich auf Fanggrenzen für 2026
Der Rat hat heute eine politische Einigung über neue Fanggrenzen für die wichtigsten Fischbestände der Ostsee erzielt , zu denen Hering, Kabeljau, Scholle, Sprotte und Lachs gehören, um nachhaltige Bestände und einen lebensfähigen Sektor für die Zukunft zu gewährleisten.
Die Einigung über die zulässigen Gesamtfangmengen (TACs) und nationalen Quoten für das Jahr 2025 steht im Einklang mit den wissenschaftlichen Empfehlungen des Internationalen Rates für Meeresforschung (ICES) und legt die Höchstmengen fest, die jedes Mitgliedsland für jeden Fischbestand fangen darf.
Die EU-Fischereiminister berücksichtigten sowohl ökologische als auch sozioökonomische Aspekte und strebten danach, nachhaltige Fischereipraktiken sicherzustellen und gleichzeitig den Lebensunterhalt der in der Fischereiindustrie tätigen Menschen zu sichern.
Der Lebensunterhalt der Fischer hängt von der langfristigen Nachhaltigkeit unserer Fischbestände ab. Mit der heutigen Einigung wollen wir ein Gleichgewicht zwischen der Unterstützung der Erholung der Fischbestände, dem Schutz der Meeresökosysteme und der Sicherung der Zukunftsfähigkeit des Sektors herstellen.
István Nagy, ungarischer Landwirtschaftsminister
Das Abkommen im Einzelnen
Hering
Der Heringsbestand in der zentralen Ostsee hat im vergangenen Jahr das Mindestmaß überschritten. Darüber hinaus sind die wissenschaftlichen Prognosen für diesen Bestand positiv. Daher hat der Rat beschlossen, die Fangmöglichkeiten im Einklang mit dem Vorschlag der Kommission um 108 % zu erhöhen.
Der Rat ist außerdem den Empfehlungen der Kommission bezüglich des Herings im Rigaischen Meerbusen und des Herings im Bottnischen Meerbusen gefolgt und hat angesichts der positiven wissenschaftlichen Gutachten die Fanggrenzen um 10 % bzw. 21 % erhöht.
Im Falle des Herings in der westlichen Ostsee einigte sich der Rat aufgrund der geringen Biomasse darauf, die TAC des letzten Jahres für unvermeidbare Beifänge zu übernehmen . Damit sind Fische gemeint, die unbeabsichtigt beim Fischen auf andere Arten gefangen werden. Der Rat beschloss außerdem, die derzeit geltende Ausnahmeregelung für die kleine Küstenfischerei beizubehalten.
Kabeljau
Da die Dorschbestände in der östlichen und westlichen Ostsee in einem schlechten Zustand sind, hat der Rat beschlossen, weiterhin TACs nur für Beifänge festzulegen , um eine Erholung der Bestände zu ermöglichen. Im Vergleich zum Vorjahr wurden die Fanggrenzen um 28 % bzw. 22 % gesenkt. Um zur Verbesserung der Situation dieser Bestände beizutragen, hat der Rat dem Vorschlag der Kommission zugestimmt, den Freizeitfischfang auf Dorsch im gesamten Gebiet zu verbieten , wobei jedoch unbeabsichtigte Beifänge berücksichtigt werden.
Scholle
Die Fangquoten für Scholle bleiben gegenüber 2024 unverändert . Obwohl die Schollenbestände gesund sind, berücksichtigt die TAC für Schollen die Tatsache, dass beim Fang von Schollen unbeabsichtigt Kabeljau gefangen wird.
Sprotte
Der Rat einigte sich darauf, die zulässige Gesamtfangmenge für Sprotten im Einklang mit wissenschaftlichen Empfehlungen um 31 % zu senken, um einen Rückgang unter ein nachhaltiges Niveau zu verhindern.
Lachs
Der Rat beschloss, die Fangquoten für Lachs im Hauptbecken um 36 % zu senken und die TAC des letzten Jahres für Lachs im Finnischen Meerbusen beizubehalten .
Darüber hinaus wird der Freizeitfischfang auf Lachse im Hauptbecken auf den Fang von maximal einem Exemplar eines Lachses mit abgeschnittener Fettflosse pro Fischer und Tag beschränkt. Nach dem Fang des ersten Exemplars müssen Freizeitfischer den Lachsfang für den Rest des Tages einstellen.
Stintdorsch
Der Rat beschloss außerdem die Fangmöglichkeiten für Stintdorsch in der Nordsee, einem Bestand, den sich die EU und das Vereinigte Königreich teilen. Nach Konsultationen mit dem Vereinigten Königreich einigten sich die Delegationen darauf, eine EU-Grenze von 300 Tonnen ausschließlich für Beifänge festzulegen.
Nächste Schritte
Der Rat wird den Beschluss in einer der nächsten Sitzungen formal verabschieden, sobald der Text in allen Sprachen fertiggestellt ist.
Hintergrund
Der Rat legt fest, wie viel Fisch in EU-Gewässern gefangen werden darf, um eine Erschöpfung der Fischbestände zu verhindern. Dem Rat kommt bei der Festlegung dieser Fanggrenzen eine Schlüsselrolle zu, da er allein über die Entscheidungskompetenz in diesem Bereich verfügt.
Die Zustimmung des Rates beruht auf einem Vorschlag der Kommission und folgt den wissenschaftlichen Empfehlungen des ICES. Darüber hinaus steht sie mit den Zielen der Gemeinsamen Fischereipolitik sowie den Bestimmungen des Mehrjahresplansfür die Ostseebestände im Einklang .
Die Arbeit von BALTFISH , dem regionalen Fischereiforum für die Ostsee, dessen Vorsitz derzeit Deutschland innehat, trug zu den Bemühungen des Rates um die Erzielung einer Einigung bei.
Die Ostsee ist das am stärksten verschmutzte Meer Europas und steht vor zahlreichen Herausforderungen, darunter dem Verlust der Artenvielfalt, dem Klimawandel, den Auswirkungen der Überfischung in der Vergangenheit sowie einem hohen Schadstoff- und Abfallaufkommen. Um diese Herausforderungen anzugehen und eine nachhaltige Fischerei und eine gesunde Meeresumwelt zu gewährleisten, bevorzugt die EU einen langfristigen Nachhaltigkeitsansatz.
Fangmöglichkeiten in der Ostsee für 2025 – Tabelle
Vorschlag der Kommission
Bewirtschaftung der Fischbestände der EU (Hintergrundinformationen)
[2] Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, 22. Okt. 2024 Pressemitteilung Nr. 116/2024
Auch 2025 keine Entwarnung für die Ostseefischerei in Sicht
EU-Fischereirat trifft notwendige Entscheidungen zur Bestandserholung – kleine Küstenfischerei kann weiterhin auf Hering fischen
Der Rat der EU-Fischereiministerinnen und -minister hat heute in Luxemburg die Fangquoten für die Fischbestände in der Ostsee für das Jahr 2025 beschlossen. Auch im kommenden Jahr muss die gezielte Fischerei auf die für Deutschland wichtigen Bestände Dorsch und Hering in der westlichen Ostsee grundsätzlich geschlossen bleiben.
Positiv hervorzuheben ist, dass sich in diesem Jahr die ersten Anzeichen einer Bestandserholung beim westlichen Hering weiter verstärken. Deutschland konnte sich nach schwierigen Verhandlungen erfolgreich dafür einsetzen, dass die kleine Küstenfischerei beim westlichen Hering mit passiven Fanggeräten, wie Stellnetzen und Reusen, weiterhin in begrenztem Umfang möglich bleibt. Der Zustand der Dorschbestände bleibt jedoch kritisch, eine Erholung ist weiterhin nicht in Sicht. Daher hat der Rat die Schließung der gezielten Fischerei sowie der Freizeitfischerei fortgesetzt und eine Absenkung der zulässigen Dorschbeifänge beschlossen. Beeinträchtigungen für die Plattfischfischerei werden dadurch aber nicht erwartet. Zudem hat sich Deutschland erfolgreich für die Fortführung der Freizeitfischerei auf Lachs im bisherigen Umfang eingesetzt, so dass weiterhin ein Besatzlachs je Angler und Tag erlaubt bleibt.
Zu dem Beschluss über die Ostseequoten erklärt Bundesminister Cem Özdemir: "Um die Talsohle zu überwinden, müssen sich die Dorsch- und Heringsbestände in der Ostsee erholen. Der heutige Quotenbeschluss ist deshalb entscheidend, um den Druck von den Fischbeständen zu nehmen. In den Verhandlungen haben wir hart um die Zukunft unserer krisengeschüttelten Küstenfischer gekämpft und erreicht, dass ihre wirtschaftliche Grundlage erhalten bleibt. Wichtig ist mir zu betonen, dass diese Ausnahme für die kleine Küstenfischerei des westlichen Herings keine negativen Auswirkungen für die Bestandserholung hat. Die Ostseefischerei wird langfristig nur dann eine Zukunft haben, wenn wir das Ökosystem und die Fischbestände wieder in einen gesunden Zustand bringen. Nachhaltige Nutzung und der Schutz unserer Meeresressourcen müssen Hand in Hand gehen!"
Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) setzt sich neben dem Wiederaufbau der Fischbestände auch für einen sozialverträglichen Strukturwandel und für eine Neuausrichtung der Ostseefischerei ein, um verbleibenden und zukünftigen Fischerinnen und Fischern eine Perspektive zu bieten. Die konkreten Maßnahmen der Leitbildkommission zur Zukunft der deutschen Ostseefischerei und der Zukunftskommission Fischerei zielen darauf ab, die Küstenfischerei an der Ostsee zu erhalten, unter anderem durch die Diversifizierung des Berufsbildes, finanziert aus Mitteln des Windenergie-auf-See-Gesetzes.
Bei Sprotte sinkt die Fangmenge um rund 30 Prozent, für Scholle beschloss der Rat unter Berücksichtigung unvermeidbarer Dorsch-Beifänge eine Fangmenge auf der Höhe des Vorjahres. Für die beiden Dorschbestände wird die Beifangmenge abgesenkt – bei östlichem Dorsch um rund 28 Prozent und bei westlichem Dorsch um rund 22 Prozent.

Ein Artikel mit Forderungen für Angler, Angeln und Anglerschutz beim Meeresangeln, auch und gerade Ostsee:
"Ruiniert: ANGELN an NORD- und OSTSEE"